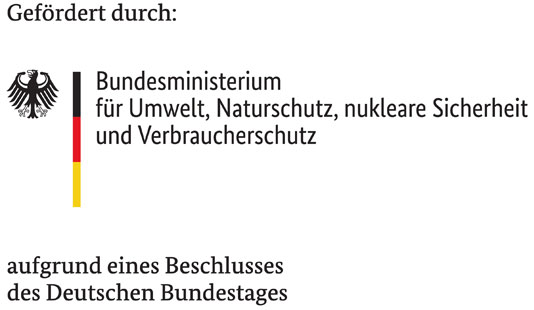Startseite » BioWiki
BioWiki

Strandhafer
Entlang der Außenküste an der Schatzküste kann man ihn finden, den Strandhafer. Die Pflanze liebt den Sand und ist ein Pionier, wenn es darum geht, hier Fuß zu fassen. Mit seinen Wurzeln festigt der Hafer im Umkreis bis zu fünf Metern den sandigen Untergrund von Dünen und Stränden. Nun ist der Weg für andere pflanzliche und tierische Bewohnern in diesen Lebensraum geebnet. Lang werden die Wurzeln der Pflanze, bis zu mehreren Kilometern. So hält der Strandhafer den Sand fest und verdichtet den Untergrund: Wasser und Nährstoffe verbleiben im Boden und andere Pflanzen finden hier bessere Lebensbedingungen. Empfindlich reagiert die Pflanze auf Trittschäden. Ist sie beschädigt stirb auch das Wurzelwerk ab und der Sand kann nicht mehr gehalten werden. Doch der Hafer kann sich recht schnell auf einzeln Wurzelresten regenerieren. Als eine der Nähnadeln der Dünen hält der alles zusammen. Mehr Informationen unter www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/pflanzen/strandhafer/

Avifauna
Avis ist die lateinische Bezeichnung für Vogel. Der lateinische Begriff Fauna leitet sich vom Namen der römischen Göttin Fauna ab, der Natur- und Waldgöttin. Die Fauna bezeichnet die Gesamtheit aller in einem bestimmten geographischen Gebiet oder Habitat vorkommenden Tierarten. Die Avifauna ist also die Vogelwelt in einem Gebiet. In Deutschland weudern seit 1800 bisher 551 Vogelarten beobachet. Insgesamt gibt es zurzeit 305 Brutvogelarten, davon kommen 29 inzwischen nicht mehr als Brutvögel vor. Weitere Faunen: Entomofauna – Insekten Herpetofauna – Reptilien und Amphibien Ichthyofauna – Fische Malakofauna – Weichtiere Quelle: www.avi-fauna.info/ Bild: Wikipedia, Marek Szczepanek (Braunkehlchen)

Wanderkorridor
Laubfrösche, Kröten aber auch viele andere Amphibien und Wildtiere haben es heute schwer. Ihre einst vernetzten Lebensräume sind durch Landwirtschaft, Siedlungen und Straßen voneinander getrennt. Fast zwei Drittel (rund 62 Prozent) der Landesfläche von Mecklenburg-Vorpommern werden landwirtschaftlich genutzt. Über acht Prozent sind Siedlungs- und Verkehrsflächen, allein die Länge aller Straßen außerhalb von Ortschaften umfasst ca. 20.020 km (Statistisches Jahrbuch 2020). Die oft überlebenswichtigen Wanderungen zwischen den verschiedenen Habitaten sind immer weniger möglich. Viele Arten sind deshalb vom Aussterben bedroht. Das Verbundprojekt Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste will das ändern: Gemeinsam mit Gemeinden, Verbänden und regionalen Akteurinnen sollen regionaltypische Lebensräume aufgewertet und besser miteinander verbunden werden. Dazu werden in den nächsten fünf Jahren Kleingewässer und Sölle renaturiert, Hecken und Gehölze gepflanzt und Wildblumenwiesen angelegt. Bild: wikipedia © Guido Gerding

Kopfweide
Silber- und Bruchweiden wurden in früheren Jahrhunderten angepflanzt, um die Triebe, auch Ruten genannt, in Korbmacherei, aber auch im Fachwerkbau und zur Herstellung von Zäunen zu nutzen. Dazu wurde den Weiden jährlich die Baumkrone geköpft. Seinen Namen verdankt der Baum der Verdickung, dem Kopf, aus dem die jungen Triebe sprießen. Der regelmäßige Schnitt begünstigt die Ausbildung von Höhlen, in denen zum Beispiel Steinkäuze und Fledermäuse leben. Besonders ältere Kopfweiden neigen im Inneren zum Ausfaulen des Stammes, während außen der Baum weiterwächst. Im mulmigen Inneren fühlen sich mehr als rund 400 Insektenarten, aber auch andere Pflanzen, Pilze, Amphibien, Säugetieren und Singvögel wie Weidenmeise, Grauschnäpper und Gartenrotschwanz wohl. Ein Paradies der Artenvielfalt. In Mecklenburg-Vorpommern prägen Kopfweiden das Erscheinungsbild der Landschaft. Einige sind schon etwa 400 Jahre alt. Weil sie aber wirtschaftlich keine Bedeutung mehr haben, werden sie vielerorts vernachlässigt.

Lebensraum
Ein Lebensraum ist das Gebiet, in dem sich eine bestimmte Pflanzen- oder Tierart vorwiegend aufhält. Für das Reh ist es der Wald, für den Schmetterling die Wiese, für Forellen ein Bach, für den Sonnentau das Moor. Das Wort „Habitat“ stammt vom lateinischen Wort „habere“ ab, das „halten“ oder „haben“ bedeutet. Laut Fora-Fauna-Habitat-Richtlinie gibt es 231 Lebensraumtypen auf der Erde, in Deutschland kommen 93 vor. An der Schatzküste wechseln sich beispielsweise Bodden, Windwatt und Flachwasserbereiche mit Sandbänken, Riffen, Flach- und Steilküsten ab. Der unterschiedliche Salzgehalt, die verschiedenen Tiefenzonen und Küstenformen ermöglichen diversen Arten das Leben und Gedeihen. Im Unterschied zu den Lebensräumen definieren Biotope Gebiete, die eine ganz bestimmte Gemeinschaft von Tier- und Pflanzenarten aufweisen. Biotop leitet sich von den zwei griechischen Wörtern „Bios“ Leben und „Topos“ Ort ab. So ist die Kopfweide ein Baum, in dem ganz bestimmte Vögel, Insekten, Pflanzen, Pilze, Amphibien und Säugetiere leben. Ein Lesesteinhaufen wird von ganz speziellen Pflanzen bewachsen, die es warm und extrem trocken mögen. Im Haufen überwintern Insekten wie Marienkäfer, aber auch Reptilien wie Zauneidechse und Schlingnatter.

Strandlebensraum
Wer an die Ostsee denkt, träumt sofort von kilometerlangen Stränden und herrlichen Dünen aus feinstem Sand, ideal zum Sonnen und Buddeln. Nur die wenigsten ahnen, dass hier nicht nur Urlauber ein Paradies finden, sondern auch ganz besondere Tiere und Pflanzen. Der mit lila Blüten gespickte Meersenf und die nur zehn Zentimeter hohe Salzmiere gehören zu den bewundernswerten Pionieren, die im blanken, trockenen Sand wurzeln. Die so entstehenden Mini-Dünen sind Brutgebiet für Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalben. Nach jedem Sturm werden Überreste der Unterwasservegetation ans Ufer gespült, bilden dort den Spülsaum. Er ist das Lebenselixier des Strandes, reich an Nährstoffen. Er ist Lebensraum zahlreicher Insekten und kleiner Krebstiere wie dem für Menschen absolut ungefährlichen Strandfloh. Dieser ist wiederum ein Leckerbissen für Watvögel wie Alpenstrandläufer und Sandregenpfeifer.

Spülsaum
Nach jedem Sturm, vor allem aber in den Wintermonaten, werden Überreste der Unterwasservegetation wie Algen, Seegras, aber auch Muschelschalen und tote Meerestiere ans Ufer gespült, das ist der Spülsaum. Er ist Lebensraum zahlreicher Insekten und kleiner Krebstiere wie dem für Menschen absolut ungefährlichen Strandfloh. Bei der Zersetzung des Materials entsteht eine Art Kompost, der Dünger des Strandes. Seine Nährstoffe ermöglichen es asketischen Pflanzen wie Meersenf, Meerkohl und Salzmiere, sich anzusiedeln. Die so entstehenden Mini-Dünen sind Brutgebiet für Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalben.

Blühstreifen
An schmalen Bereichen am Feld- oder Straßenrand, an Autobahnen oder in Gemeinden werden immer öfter blühende Pflanzen ausgesät. Sie dienen Insekten als Lebensraum, darunter landwirtschaftlichen Nützlingen, die einen Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung leisten. Die Streifen sind aber auch Nahrungsquelle für Bestäuber und Schutzraum für Wildtiere. Besonders wertvoll für den Erhalt von Biodiversität sind mehrjährige Blühstreifen. Inhalt der einjährigen Samenmischungen sind schnell blühende Kulturpflanzen. Diese sind nicht winterhart, können also auch erst nach dem letzten Frost ausgebracht werden. Für einige Wildbienenarten ist das zu spät. Im Unterschied dazu werden auf mehrjährigen Blühstreifen Wildpflanzenarten mit angesät, die nach dem ersten Winter früh zu blühen beginnen. Willkommener Rastplatz für diese Insekten ab dem zweiten Jahr. Besonders gut geeignet sind regionale Samenmischungen. Sie sind optimal an den Lebensraum angepasst und bieten vor allem regionalen Insekten- und Tierarten Nahrung und Unterschlupf. Auch im Winter finden diese in Halmen, der Erde oder unter Pflanzenbüscheln über längere Zeit sichere Rückzugsräume. Für die Ausbringung sollten immer unbelastete regionale Samenmischungen verwendet werden. Oft werden auch Kulturen wie z.B. Sonnenblumen als Streifen angepflanzt.

Sandkliff
Die Außenküsten der Ostsee wurden durch Wasser und Wind geformt. Dort wo Steilküsten durch die Eiszeiten bedingt vorhanden sind, arbeitet die Brandung an der Gestalt der Küste. Nach und nach entstand so eine Aushöhlung, die Brandungshohlkehle. Daraus entwickelte sich über die Zeit durch die Unterschneidung ein Kliff. Die herausgebrochenen Gesteine werden dabei durch die Brandung aufgearbeitet und als Strandgeröll abgelegt. In ein Sandkliff, das relativ „weichen“ Boden hat, können auch Vögel, wie hier die Schwalben, ihre Bruthöhlen hineinbauen. Quelle: http://www.geodz.com/deu/d/Brandungsformen Schwalben am Sandkliff (NABU MV)

Watvögel
Besonders lange Beine ermöglichen ihnen das Durchwaten der flach überfluteten Wattflächen. Langgezogene Schnäbel erlauben ihnen, in Sand und Schlick herumzustochern. Muscheln, Würmer und andere Kleintiere werden so erbeutet. Als Watvögel bezeichnet man regenpfeiferartige Vögel, die mit ihren meist langen Beinen durch Schlamm und Flachwasser waten, um mit ihren meist langen Schnäbeln nach Nahrung im Grund zu suchen. Jede Watvogelart hat dabei ihre eigene spezifische Jagdstrategie, bestimmt durch Schnabellänge und Schnabelform. In den Windwatten zwischen Rostock und Rügen sind es vor allem der Alpenstrandläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, Säbelschnäbler und Große Brachvogel.Dazu gehören beispielsweise Austernfischer, Brachvogel, Regenpfeifer, Schnepfe, Säbelschnäbler. Watvögel sind weltweit anzutreffen, sogar in den kalten Regionen in Polnähe. Viele leben in Wassernähe an Meeresküsten, Seen, Flüssen und in Sümpfen, aber auch in trockenen Regionen wie Halbwüsten, Steppen und Hochgebirgen. Fast alle Arten sind Zugvögel. Auch der Begriff „Watt“ hat seinen Ursprung in der Beschreibung der Fortbewegung. Mit „wada“ umschrieben die alten Friesen die Landschaft, die „durch waten passierbar ist, seicht, untief“. Quelle: SchatzLotse Naturschätze – Die Lebensräume der Küstenlandschaft © wikipedia